Von Dr. Ramy Abdel Mawgoud
Motivation zu meinem Auslandsaufenthalt
Im Rahmen meines Medizinstudiums suchte ich nach einer Möglichkeit, nicht nur meine klinischen Fähigkeiten zu erweitern, sondern auch wertvolle internationale Erfahrungen zu sammeln. Besonders interessierte mich die Dermatologie – ein Fachbereich, der weltweit stark nachgefragt wird. Melbourne, eine pulsierende Stadt mit einer florierenden medizinischen Landschaft und internationalem Renommee, erschien mir als idealer Ort für ein Praktikum. Australien ist ebenso wie Österreich für seine hohe Lebensqualität und den modernen Umgang mit Gesundheitsthemen bekannt.

Durch das Praktikum erhoffte ich mir, tiefere Einblicke in die dermatologische Versorgung zu gewinnen – insbesondere in die Hautkrebsprävention, die in Australien aufgrund des hohen UV-Index eine zentrale Rolle spielt. Mein Ziel war es, nicht nur mein Fachwissen in diesem Bereich zu vertiefen, sondern auch praktische Erfahrungen im Umgang mit innovativen Diagnose- und Behandlungsmethoden zu sammeln.
Darüber hinaus faszinierte mich die multikulturelle Vielfalt Melbournes, eine Stadt, die stark von internationalen Einflüssen geprägt ist. Diese Diversität empfand ich als besonders bereichernd, da sie mir ermöglichte, mit einer breit gefächerten Patientenpopulation in Kontakt zu kommen. Diese reichte von einheimischen Australiern über Einwanderer aus Europa und Asien bis hin – wenn auch seltener – zu indigenen Bevölkerungsgruppen. Jede dieser Gruppen brachte eigene gesundheitliche Herausforderungen, genetische Prädispositionen sowie kulturell geprägte Vorstellungen von Krankheit und Behandlung mit sich. So wiesen beispielsweise Bevölkerungsgruppen mit nord- oder westeuropäischem Ursprung ein erhöhtes Hautkrebsrisiko aufgrund ihrer helleren Hauttypen auf. Bei anderen wiederum traten vermehrt dermatologische Erkrankungen auf, die in Zusammenhang mit spezifischen Umweltfaktoren standen. Letzteres ließ sich etwa in den vorstädtischen Gebieten „Dandenong“ und „Clayton“ beobachten, wo aufgrund der zunehmenden Zahl afghanischer Asylsuchender eine Zunahme von Leishmaniose-Fällen verzeichnet wurde.
Die Monash University richtete zudem eine eigene, kostenfreie Anlaufstelle für die medizinische Versorgung von PatientInnen indigener Abstammung ein. Dies war als Ausdruck der Dankbarkeit und Erinnerung an die ursprünglichen Besitzer dieses Landes zu verstehen.
Der interkulturelle Austausch eröffnete mir neue Perspektiven auf unterschiedliche gesundheitliche Bedürfnisse, medizinische Versorgungsansätze und patientenspezifische Herausforderungen.
Bewerbung und Anmeldung
Die Bewerbung für das Praktikum in Melbourne gestaltete sich insgesamt relativ unkompliziert. Über die Universitätsplattform der Monash University konnte ich mich direkt bei verschiedenen Kliniken bewerben, und schließlich wurde ich für das Praktikum am Monash University Hospital aufgenommen.
Allerdings war es entscheidend, meine Unterlagen frühzeitig einzureichen, da die Nachfrage nach Praktikumsplätzen in Australien sehr hoch ist. Glücklicherweise verlief die Kommunikation mit der dermatologischen Abteilung in Melbourne dank der Vermittlung eines ehemaligen Primars reibungslos, sodass der Bewerbungsprozess zügig abgeschlossen werden konnte.
Die eigentliche Herausforderung lag in der Organisation der bürokratischen Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Visum und der Krankenversicherung. Der australische Arbeitsmarkt ist stark reguliert, und für das erforderliche Visum musste ich eine umfassende Gesundheitsuntersuchung in einer privaten Praxis durchführen lassen – eine verpflichtende, aber kostenpflichtige Maßnahme. Zusätzlich erhob die Universität eine Studiengebühr für internationale Studierende, was eine sorgfältige finanzielle Planung erforderte. Trotz dieser administrativen Hürden lohnte sich der Aufwand, da mir das Praktikum eine einzigartige Möglichkeit bot, wertvolle fachliche und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.
Meine Tätigkeit und Arbeitsbedingungen am Monash University Hospital

Das Monash University Hospital ist ein großes, modernes städtisches Krankenhaus, das mit fortschrittlicher Technologie und innovativen Behandlungsmethoden ausgestattet ist. Die Arbeitsbedingungen auf der dermatologischen Abteilung waren ausgezeichnet, und ich wurde sehr schnell in das interdisziplinäre Team integriert, was mir ermöglichte, mich von Anfang an aktiv in den klinischen Alltag einzubringen. Ich konnte nicht nur an Visiten teilnehmen, sondern auch an Besprechungen, bei denen die ÄrztInnen die individuellen Krankheitsverläufe und Behandlungsansätze der PatientInnen besprachen. Diese direkte Teilnahme ermöglichte es mir, einen realistischen und praxisnahen Eindruck von der Arbeit in einer dermatologischen Abteilung zu gewinnen.
Da die Dermatologie in Melbourne keine stationäre Abteilung war, beschränkten sich meine „Tätigkeiten auf den ambulanten Bereich. Dabei hatte ich die Möglichkeit, die OberärztInnen zu „shadowen“. Das bedeutete, dass die AssistenzärztInnen die PatientInnen in den Behandlungszimmern zunächst eigenständig betreuten und erst zur abschließenden Visite den Oberarzt bzw. die Oberärztin – gemeinsam mit mir – hinzuzogen. So konnte ich eine große Zahl an Fällen sehen, was in einem so visuell geprägten Fach wie der Dermatologie einen großen Vorteil darstellt. Darüber hinaus durfte ich bei Stanzbiopsien und Hautprobeentnahmen nicht nur assistieren, sondern diese unter Supervision auch eigenständig durchführen. Die eigenverantwortliche Betreuung eines eigenen Ambulanzraums wäre für Studierende ebenfalls möglich gewesen, sofern entsprechendes Interesse bestand.
Besonders spannend war der wöchentliche interdisziplinäre Austausch im Tumor-Board, bei dem DermatologInnen, OnkologInnen und plastische ChirurgInnen gemeinsam komplexe Fälle diskutierten. In diesen Sitzungen wurde nicht nur die Diagnose besprochen, sondern auch die bestmöglichen Behandlungsstrategien für Hautkrebs – insbesondere in fortgeschrittenen Stadien – erörtert. Durch diesen intensiven Dialog konnte ich umfassende Einblicke in die verschiedenen Therapieansätze gewinnen. Im Rahmen eines jährlich stattfindenden Dermatologie-Onlinetreffs hatte ich zudem die Gelegenheit, einen spannenden Fall interdisziplinär vorzustellen. Es handelte sich hierbei um einen Fall der Cutis laxa Typ 2, welche ohne greifbare Ursache verblieb. Gemeinsam mit meinem Mentor präsentierte ich den Fall und diskutierte ihn mit ExpertInnen im Hinblick auf mögliche weitere diagnostische Schritte und bislang unberücksichtigte Ursachen.
Im Vergleich zu meiner Heimat herrscht in Australien eine flachere Hierarchie innerhalb der Teams, was mir ermöglichte, aktiver an den Diskussionen teilzunehmen. Die Kommunikation im Team war sehr offen, und ich wurde regelmäßig in Fallbesprechungen eingebunden. Sprachbarrieren gab es keine, da alle medizinischen Fachkräfte Englisch sprachen. Allerdings gab es gelegentlich Unterschiede im medizinischen Vokabular, die zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig waren.
Die Arbeitszeiten variierten je nach Woche, aber im Durchschnitt arbeitete ich etwa 30 Stunden pro Woche. Der Arbeitsalltag in Australien war im Vergleich zu anderen Ländern tendenziell ausgewogen, was eine gute Work-Life-Balance ermöglichte. Zudem gab es regelmäßig Fortbildungen, bei denen wir über die neuesten Entwicklungen in der Dermatologie, insbesondere in der Hautkrebsbehandlung und innovativen Therapien, informiert wurden. Gegenstand rezenter Forschung bleiben weiterhin die Biologika-Therapien im Bereich der chronisch entzündlichen Hauterkrankungen. Zudem wurde ich zu einem Symposium eines solchen Herstellers gemeinsam mit meinem Team eingeladen und durfte mehr über den sogenannten „compassionate use“ erfahren; eine von jenen Herstellern zu vergünstigten Preisen angebotene Quote an Biologika, welche angesichts des „halbprivatisierten“ Gesundheitssystems in Australien den Bedürftigen angeboten wird.
Mein Arbeitsplatz
Die dermatologische Abteilung betreute täglich etwa 40-50 ambulante PatientInnen, die meist zur Kontrolle kamen. Eine traditionelle dermatologische Bettenstation existierte nicht, stationäre Fälle wurden auf Konsiliarbasis behandelt – ein Trend, der in Zukunft möglicherweise auch Europa erreichen könnte. Dermatologische PatientInnen weisen häufig zahlreiche Komorbiditäten auf, die sie zusätzlich zu komplexen stationären internistischen Fällen machen können. Durch ein solches System würden DermatologInnen sowie internistische Konsiliardienste auf den Stationen zwar entlastet werden;

gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass stationäre PatientInnen nicht mehr ganzheitlich, sondern primär aus dermatologisch-konsiliarischer Perspektive betrachtet werden.
Das Team setzte sich aus rotierenden Fachärzten, mehreren Assistenzärzten, Pflegepersonal und weiteren medizinischen Fachangestellten zusammen. Zum einen bedeutete dies für die AssistenzärztInnen, dass sie keine konstante Orientierung an den Standardvorgehensweisen eines festen Fachärzteteams hatten. Andererseits blieb das Team dadurch deutlich dynamischer, und es kamen mehr unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zusammen, als es in einem festen „Stammteam“ möglich gewesen wäre. Besonders beeindruckt war ich von der effizienten Organisation, die vor allem durch die weitgehend elektronische Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und der Krankenkasse ermöglicht wurde. Auch die australische Höflichkeit spiegelte sich im Arbeitsalltag spürbar wider.
Versicherungen
Während meines gesamten Aufenthalts war ich durch eine Auslandskrankenversicherung der UNIQA versichert, die alle medizinischen Behandlungen abdeckte. Das australische Gesundheitssystem, das durch Medicare unterstützt wird, sorgt für eine hochwertige medizinische Versorgung für alle Bürger sowie für viele langfristige Aufenthalte. Als Praktikant war ich jedoch auf eine private Versicherung angewiesen. Die erforderliche Haftpflichtversicherungsbestätigung erhielt ich problemlos über die ÖH Med Wien.
Fazit
Mein Auslandspraktikum in Melbourne war eine einzigartige Gelegenheit, meine medizinischen Fachkenntnisse zu vertiefen und gleichzeitig die Kultur sowie das Gesundheitssystem eines anderen Landes kennenzulernen. Es hat mir verdeutlicht, wie entscheidend Prävention im Gesundheitswesen ist und wie unterschiedlich die Herausforderungen in der globalen medizinischen Versorgung sein können.
Kostentabelle
| Beschreibung | Kosten in Euro |
|---|---|
| Unterkunft pro Monat | 1300 |
| Essen und Trinken pro Monat | 700 |
| Transport (öffentliche Verkehrsmittel) pro Monat | 180 |
| Freizeitaktivitäten | 200 |
| Kosten pro Monat | 2380 |
| Flug (Hin- und Rückflug) | 1300 |
| Gesamtkosten | 3680 |
Interessante Webseiten
- Visa Medicals: Die Gesundenuntersuchung wird hierorts nur in dieser Ordination angeboten.
- Department of Home Affairs: Online Visum beantragen. In Australien
- Monash University: Website des Krankenhauses, in dem ich mein Praktikum absolvierte.
- Visit Melbourne: Offizielle Tourismus-Seite von Melbourne, mit hilfreichen Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Stadt.
Fotos
Kontakt
Bei Fragen zu Vorname Nachnames Famulatur, oder bei Fragen an Vorname Nachname persönlich, wenden Sie sich direkt an die GI-Redaktion. Schreiben Sie uns ein E-Mail an: media@goinginternational.org
Haben Sie Fragen zu den Themen Arbeiten & Weiterbildung oder Jobsuche & Karriere? Dann schreiben Sie an Frau Mag. Seitz: office@goinginternational.org
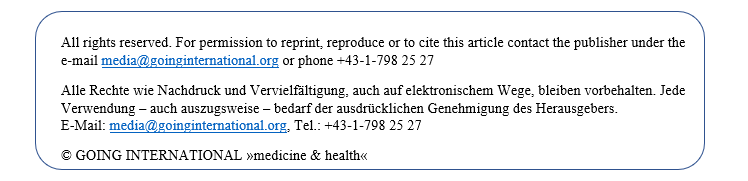
Zitierung:
Mawgoud, Ramy Abdel: „Mein Auslandspraktikum in der Dermatologie der Monash University in Melbourne, Australien“
Diese Publikation steht hier zum Download bereit.
Wird veröffentlicht in GI-Mail 09/2025 (Deutsche Ausgabe).
- Kennen Sie unseren monatlichen Newsletter GI-Mail mit Tipps zu postgradualen Lehrgängen und Kongressen? Hier geht es zur Anmeldung.
- Sind Sie auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen/Jobs & Vakanzen? Hier finden Sie die aktuellen Stellenangebote.
- Kennen Sie schon unsere monatliche Job-Information GI-Jobs mit aktuellen Stellenangeboten für ÄrztInnen, ManagerInnen und dipl. Fachpflegekräfte? Hier geht es zur Anmeldung.
- Sind Sie an neuen postgraduellen Kursen und CME-Weiterbildung interessiert? Laufend neue Kurse & Kongresse von mehr als 2300 Veranstaltern finden Sie in der Bildungsdatenbank »medicine & health«
